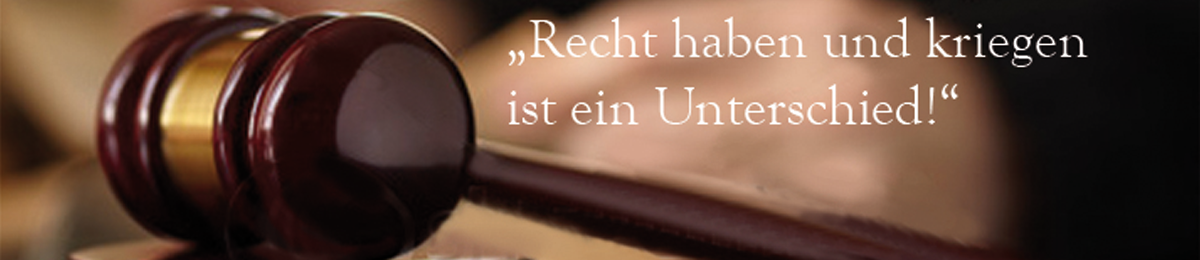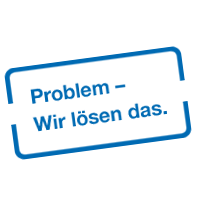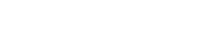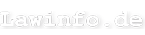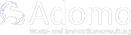Digitales Erbe lebt weiter
Viele Menschen schaffen sich im Laufe ihres Lebens durch private E-Mail-Postfächer oder Facebook-Profile eine digitale Existenz, die im Laufe der Zeit sehr viel Persönliches und mit unter auch „Geheimes“ enthält. Diese digitale Existenz lebt über den Tod hinaus fort. Was mit den Daten, dem dort enthaltenen Wissens- und Informationsfundus und den damit verbunden Daten und Profilen geschehen soll, regeln bisher die meisten Menschen zeit ihres Lebens nicht.
Im Zweifel haben die Erben später Anspruch auf Einblick in die sozialen Netzwerke und Accounts oder man regelt diesen digitalen Nachlass im Vorfeld.
Oftmals sollen die Erben gerade nicht alles wissen oder alles herleiten können oder von persönlichen Vorlieben und Abneigungen Kenntnis erlangen. Hat man früher persönliche Briefe einfach im Kamin verbrannt, wären elektronische Daten im Vorfeld rückstandslos zu löschen, was in vielen Fällen nicht (rechtzeitig) gelingt. Wer soll's in dem Fall richten?
In einem solchen Fall empfiehlt sich beispielsweise eine testamentarische Verfügung mit einer extra „Digitalklausel“. Im Testament kann geregelt werden, dass eine bestimmte Person des Vertrauens sich nach dem Ableben um den digitalen Nachlass kümmert und diesen verteilt, vernichtet oder im Sinne des Erblassers fortführt. Da hier die rechtlichen Grundlagen noch nicht so gefestigt sind wie in klassischen Erbangelegenheiten, Dinge in den nächsten Jahren noch andere Bedeutungen und Gewichtungen bekommen, sollte man eine solche Regelung mit einem auf diesem Rechtsgebiet spezialisierten Rechtsanwalt abklären.
Wir haben die richtige Digitalklausel für Sie!
__________________________________________________________________________________________________________________________
Vorsorgen ist besser als sich später nachärgern
Wenn man stirbt, kann einem alles egal sein. Was ist aber, wenn man wieder aufwacht? Überall Schläuche. Ab jetzt ist jeder Tag wie der andere. Über die Magensonde schmeckt alles gleich. Nein, es schmeckt gar nicht. Fünf Jahre, zehn Jahre, fünfzehn Jahre lang. Wie würden Sie sich in dieser Situation entscheiden?
Die wenigsten haben für diesen Fall tatsächlich vorgesorgt. Zwar hat jeder schon einmal von einer Patientenverfügung oder einer Vorsorgevollmacht gehört. Die wenigsten gehen dieses Thema aber in "guten Zeiten" an. Und wenn, nehmen sie oft etwas vorformuliertes "von der Stange" anstatt individuell auf die eigene Person zugeschnitten. So ging es auch Friedrich B.
Neben Testament und Vermögensübertragung zu Lebzeiten beraten wir, wann und inwieweit der Mandant selbst Einfluss auf sein Schicksal nehmen soll, bevor es andere tun. Das was der Mandant will, setzen wir dann um. Punkt.
RA Rafael Fischer ist Vorsorger und Testamentsvollstrecker.
Wie Pflichtteilsberechtigte ihren Anteil sichern können
Der Beschluss des Oberlandesgerichts München (Az.: 3 W 1443/24 e) zeigt, wie Pflichtteilsberechtigte ihr Recht auf eine Mindestbeteiligung am Nachlass durch den sogenannten Arrest sichern können. Dabei handelt es sich um ein rechtliches Instrument, das in Ausnahmefällen genutzt werden kann, um Vermögenswerte zu "einfrieren", wenn die Gefahr besteht, dass der Pflichtteilsanspruch später nicht mehr durchgesetzt werden kann. Dies erfordert jedoch eine fundierte und gut belegte Begründung.
Voraussetzungen für einen Arrest
Damit ein Arrest bewilligt wird, müssen zwei wesentliche Voraussetzungen erfüllt sein:
-
Arrestanspruch: Es muss ein konkreter Pflichtteilsanspruch bestehen. Dieser Anspruch ergibt sich aus der gesetzlichen Erbfolge und den entsprechenden Vorschriften im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB).
-
Arrestgrund: Es muss nachgewiesen werden, dass eine tatsächliche Gefahr besteht, dass der Anspruch ohne den Arrest vereitelt oder erschwert wird. Hierzu reichen bloße Vermutungen oder allgemeine Befürchtungen nicht aus. Vielmehr sind konkrete Handlungen oder Umstände erforderlich, die die Vermögensgefährdung untermauern.
Praxisrelevanz des Urteils
Das Urteil des Oberlandesgerichts München verdeutlicht, dass nicht jede Übertragung oder Veräußerung von Vermögenswerten durch Erben automatisch einen Arrestgrund darstellt. Entscheidend ist die Absicht hinter der Transaktion und ob sie objektiv den Eindruck erweckt, dass Vermögen verschleiert oder beiseitegeschafft werden soll.
Im konkreten Fall spielte das Verhalten der Erbin eine entscheidende Rolle: Sie veräußerte den einzigen werthaltigen Vermögensgegenstand (ein Grundstück), informierte den Pflichtteilsberechtigten jedoch nicht über diesen Schritt. Dies weckte Zweifel an der Redlichkeit der Erbin und begründete den Arrest.
Tipps für Pflichtteilsberechtigte
- Schnelles Handeln: Wenn Sie Hinweise darauf haben, dass Vermögen gefährdet ist, sollten Sie unverzüglich rechtliche Schritte prüfen lassen.
- Nachweisbare Begründung: Dokumentieren Sie alle Anhaltspunkte, die auf eine Vermögensgefährdung hinweisen könnten, und legen Sie diese einem erfahrenen Rechtsanwalt vor.
- Rechtliche Beratung: Die Beantragung eines Arrests ist ein komplexes Verfahren, das eine fundierte juristische Unterstützung erfordert.
Risiken und Kosten
Es ist wichtig zu beachten, dass ein zu Unrecht beantragter Arrest auch finanzielle Folgen haben kann. Der Antragsteller haftet für Schäden, die dem Erben durch einen unberechtigten Arrest entstehen. Deshalb ist eine sorgfältige Prüfung im Vorfeld unerlässlich.
Das Urteil zeigt, dass das Arrestverfahren ein wirksames Mittel zum Schutz von Pflichtteilsansprüchen sein kann – vorausgesetzt, es wird mit der notwendigen Sorgfalt und rechtlichen Expertise durchgeführt.